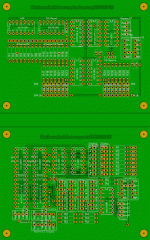Bei den Weichenmodulen und dem zugehörigen Tastenpult schrob ich oben:
"Das Tastenpult:
Auf eine 160mm Breite passen exakt 16 dieser Taster, also für 8 Weichen. Es ist auf 2 x 4 aufgetrennt, wobei jeweils 1 Steckeranschluß für die Weichenstellung und ein Steckeranschluß für die Rückmeldung ist.
Der geneigte Leser wird feststellen, daß da noch 2 4pol Anschlüße und Jumperbrücken bei sind. Das ist für die serielle Schaltung der Weichen von der Matrix der Start - Zielsetzung und der Sperrung eines manuellen Eingriffs bei gesetzter Fahrstraße vorgesehen. Dazu eventll später mehr."
Im Sbhf sind keine Direktzugriffe auf die Weichen vorgesehen (obwohl auch das gänge), weil sie halt in den Ablauf eingebunden sind. Für einen Bahnhof ist das natürlich nicht geeignet, da sollte man schon auf die einzelnen Weichen Zugriff haben aber auch nur dann, wenn keine Fahrstraße gesetzt, bzw diese noch nicht aufgelöst ist. Ein Weg, wie man das machen kann, ist folgender:

Die Weichenmodule werden über die beiden Gatter OR1 und OR2 angesteuert. Der Ausgangspegel ist entweder "Ping" H oder stehend L.
Beide OR werden jeweils an einem Eingang von AND1 bzw. AND2 angesteuert. Die AND Eingänge bekommen ihre Pegel von der Fahrstraßenmatrix und, als "Ping" H, vom Ausgang Q der D-Speicher-Register 40174.
Die beiden anderen Eingänge der OR erhalten ihren "Ping" H vom Tastenpult.
Ist keine Fahrstraße (FS) gesetzt, bzw liegt eine Weiche nicht im Fahrweg, dann werden die AND Eingang "FS W-Set" einen L Pegel haben. In dem Moment wird an beiden Eingängen des NOR1 ebenfalls ein L anliegen, an seinem Ausgang aber ein stehender H Pegel sein. Dieser H Pegel wird nun an das Tastenpult weitergegeben und zwar nur für die betreffende Weiche. Damit kann die Weiche über die nachfolgenden Eingänge von OR1 bzw OR2 und einem Momentdruck auf das Tastenpult direkt umlaufen.
Ist eine FS gesetzt, bwz liegt eine Weiche im Fahrweg, dann wird am Ausgang des NOR1 ein L anliegen, was das Tastenpult sperrt und somit auch den direkten Zugriff auf die Weiche, bis die FS aufgelöst ist.
Die D-Speicher-Register 40174 sind D (Daten) Flip-Flops. In der gezeigten Schaltung arbeiten sie als Eimerkettenschaltung, heißt, ein D-FF gibt seinen Zustand an den nächsten weiter usw.
Es gibt einen Eingang R (Reset), welcher auf H liegen muß, um Änderungen am Ausgang Q zu erreichen. Dieser H Pegel wird vom D-FF1 (4013) gesetzt.
Nun folgen am D Eingang ein "Ping" H und zeitgleich am C (Clock) Eingang ebenfalls ein "Ping" H
Der globale Takt (von der gelben Textfahne "Takt" kommend und vom Netzteil der Weichen weiter oben generiert) gelangt erst dann an den C Eingang, wenn D-FF1 (4013) gesetzt ist, demzufolge auch R auf H liegt.
Nun braucht es den Eingang "WSI" Weichen-Schaltstart-Impuls ebenfalls einen "Ping" H. Der kommt vom Fahstraßen Start - Ziel Modul. Das lasse ich jetzt mal weg - es wird ganz einfach mit einem Draht von Ub+ auf einen der Eingänge des WSI Oder Gatters (OR1) eine ganz kurzzeitiger "Ping" gesetzt.
Dieser "Ping" ist nun der Datensatz, eben ein kurzzeitiger H Pegel, der vom 1. 40174 aufgenommen und durch die globale Taktung zum nächsten und übernächsten usw 40174 weitergegeben wird. Dieser Ping wird dann die einzelnen Weichen nacheinander (seriell) umlaufen lassen. Für mag Antriebe ist das gut geeignet, weil zeitgleich nie mehr Last als eine Weiche anhängt. Bei den mot Antrieben spielt das nicht so die Rolle, da fließen pro Motor nur um die 75mA.
Wenn der Daten-H-ping den letzten Ausgang der 40174 Kette erreicht, wird er zum "WSI Stop" In dem Moment wird D-FF1 (4013) zurückgesetzt, sein Q wird L und das Spiel ist beendet.
Beendet wird das Spiel ebenfalls vom Netzreset (braune Textfahne vom Netzteil kommend) und vom Handreset (FS Reset) des Fahrstaßensetzmoduls.
Die Platinen sind geteilt. Einmal als Ansteuerlogik und dann anreibar als ausführende Platinen.
Dann sind da noch OR3, OR4, OR5 und der D-FF2 (4013).
Es ist blöd, wenn der ganze Bhf gesperrt ist, nur weil der letzte Wagen noch nicht am Asig durch ist. Von daher gibt es Teilauflösungen der Fahrstraße. Das Bündel AND3 gibt nach einer Löschung durch den Zug und die Löschung durch den "WSP" (Weichensicherunsplan) Teile innerhalb der verlassenen Fahrstraße frei, die dann durch einen Rangierauftrag wieder befahren werden können.
Das ist aber eine Vertüdelaufgabe, die ganz individuell gelöst werden muß, im Zusammenhang mit der Matrix und dem WSP.
Der Fahrauftrag im Allgemeinen wird wieder durch die Rückmeldungen der Weichenumläufe und der Freimeldung des Folgeblocks erteilt, geht an die Blockfahrregler, was zum langsamen anfahren führt.
Die SRK`s werden wieder so platziert, daß viele Funktionen darüber gesteuert werden, um die Anzahl auf das Minimum zu begrenzen. Die Aufbereitung des Signals der SRK erfolgt ebenfalls mit der weiter oben gezeigten Schaltung.
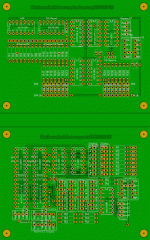


Fahrstraßenmodul - Start > Zieltaste:

Zwischen das Fahrstraßenmodul und die serielle Weichenansteuerung kommt noch die Fahrstarßenmatrix.