Instagram: Ente für Schnelllebige

Social Media ist zwar wirklich nicht mein liebster Teich, aber ich stelle immer häufiger fest, dass dort mehr Menschen auch meiner Zielgruppe - und das heißt mehr von euch - zu schwimmen scheinen, als auf den meisten anderen Plattformen. Für längere Diskussionen und ernsthafte Sachinhalte halte ich solche schnelllebigen, bunt blinkenden Plattformen für ungeeignet. Wenn es euch aber hilft, auf dem Laufenden zu bleiben und nichts zu verpassen:
👉 Klickt euch rein!
Natürlich erfahrt ihr dort, wenn es was Neues für die Eisenbahn zu kaufen gibt. Abseits dessen dreht es sich bei Quacks Welten vor allem um mein Leben als Historiker, Künstler, Autor und Bühnenmensch. Hat auch oft mit Eisenbahn zu tun, aber meistens in 1:1
🎩 Patreon: Für alle, die mehr wissen wollen 🎩

Hier gibt es die längeren Texte. Die echten Einblicke hinter die Kulissen. Mehr Modellbau, mehr Kunst, mehr Geschichten aus dem echten Leben. Mein Lieblingsteich als Historiker.
Mancher Unkenrufe zum Trotz wächst die Community dort stetig an und hat mir im Laufe des letzten Jahres eine ganze Reihe von großartigen Auftritten und neuen Kontakten verschafft, mir Zugang zu neuen Quellen und Archivmaterialien gegeben und vieles mehr. Während IG komplett kostenfrei ist, gibt es hier kostenfreie Inhalte und welche nur für Unterstützer. Der finanzielle Support, für den ich auch einigen von euch sehr danken möchte, ist die Grundlage dafüri, dass ich immer wieder Vereine unterstützen, über historische Themen recherchieren und ständig neue spannende Artikel dazu veröffentlichen kann.
Also: Wenn ihr mehr wissen wollt:
👉 Lest die Ente! 🎩
Und nicht zuletzt:
Schaut mal wieder in den Epoche-I-Shop!
Von den
Colonialwarenwagen sind noch einige da, Fischer-Modell hat ein paar schicke
graue Preußen angekündigt und Bierwagen und Mecklenburger gibt es auch noch! Und natürlich allerlei Kleinteile für "neben dem Gleis", aber das wisst ihr ja

Lasst gerne hören, was ihr von alledem haltet!


 www.quack-salber.net
www.quack-salber.net


 www.quack-salber.net
www.quack-salber.net


 Lieber:🕯️
Lieber:🕯️








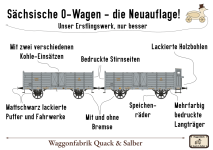
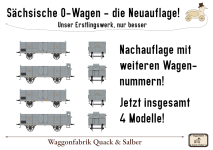
 >
>

